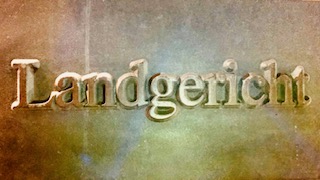Werder (Havel), 09.11.2022 – Pressemitteilung der Stadt Werder/Havel vom 9. November 2022.
Namensgebung der Resi-Salomon-Straße zum Jahrestag der Pogromnacht
Repressionen gegen Juden hat es mit zunehmender Brutalität bereits seit dem Machtantritt der Nazis im September 1933 gegeben.
„Mit dem 9. November 1938 bekam der Terror eine neue Qualität, der Weg in den Holocaust war vorgezeichnet“, so Bürgermeisterin Manuela Saß bei einem Termin zum Jahrestag der Pogromnacht am 9. November in der neuen Resi-Salomon-Straße in Glindow.
Auch in der Region Werder (Havel) sei es zu massiven Ausschreitungen gegen jüdische Einwohner gekommen, so die Bürgermeisterin. „Privathäuser und Geschäfte wurden geplündert und zerstört, die Bewohner verhöhnt, bedroht und eingeschüchtert.“
Mehr als hundert jüdische Einwohner aus Werder seien in der Nazizeit in die Emigration getrieben, deportiert oder ermordet worden. Für viele von ihnen endete der Weg in Konzentrationslagern.
Eine Arbeitsgruppe Werderaner Bürger hat in einem Gedenkbuch vor sechs Jahren an „Jüdische Schicksale“ (so lautet der Buchtitel) in der Stadt erinnert. Die Stadt Werder (Havel) hat allen Schulen Klassensätze dieses Buches bereitgestellt.
Eines der dort beschriebenen Schicksale ist das von Resi Salomon. Zum Jahrestag der Pogromnacht ist mit Stadtverordneten, Schülern des Oberstufenzentrums und Bürgern eine Straße in Glindow nach Resi Salomon benannt worden.
Die Namensgebung geht auf einen Beschluss der Stadtverordneten zurück. Bürgermeisterin Saß erinnerte an das Leben der Glindowerin, das im Gedenkbuch dokumentiert ist.
Nach der Scheidung von ihrem Mann Albert Salomon war Resi Salomon 1924 mit ihren beiden gemeinsamen Söhnen, Hans und Lutz, aus dem Rheinland nach Glindow gezogen. Offenbar hatte sie hier eine Tätigkeit als Gärtnerin und Obstzüchterin aufgenommen.
1936 erwarb sie Grundbesitz in der Klaistower Straße. Auf 7,6 Hektar betrieb sie eine Gärtnerei, Spezialität: Stauden- und Topfgewächse.
Ihr Sohn Hans wurde als Gärtner ausgebildet. Sohn Lutz nahm eine kaufmännische Lehre in Berlin auf. Als die Firma, bei der er tätig war, „arisiert“ wurde, wanderte Lutz Salomon um 1936 nach Südafrika aus.
Seit 1939 war Resi Salomon in ihrer eigenen Gärtnerei nur noch als Gelegenheitsarbeiterin tätig. Nach der Verordnung zur Arisierung jüdischer Geschäfte hatte sie ihren Betrieb zuvor an einen Glindower Gärtner verkaufen müssen.
Offenbar wollte Resi Salomon ihrem Sohn Lutz nach Kapstadt in die Emigration folgen. Der Plan misslang.
Resi Salomon wurde am 14. April 1942 in das Warschauer Getto deportiert. Von dort aus wurde sie vermutlich Ende Juli 1942 nach Treblinka deportiert, wo sie ermordet wurde.
Der Hausrat von Resi und Hans Salomon wurde am 10. Juli 1942 nach einer Ankündigung im General-Anzeiger versteigert, der Erlös von 358,65 Reichsmark ging an den Reichsfiskus.
Zwei Monate nach seiner Mutter wurde Hans Salomon nach Minsk deportiert, er ist dort ermordet worden. Seit Oktober 2014 liegen vor dem Grundstück Klaistower Straße 70 in Glindow zwei Stolpersteine für Resi und Hans Siegfried Salomon.
Die neue Resi-Salomon-Straße, die zum neuen Hoffbauer-Campus führt, ist nur ein paar Schritte davon entfernt.
Jüdische Schicksale in Werder lassen sich häufig nur aus wenigen Dokumenten wie Personenstandsakten und Adressbüchern rekonstruieren.
Auch zur Pogromnacht in Werder ist im Stadtarchiv nur ein Dokument erhalten geblieben: eine Bauakte, in der die Schäden an Wohn- und Geschäftshäusern acht jüdischer Familien in Werder dokumentiert sind.
Fünf Kopien der Bauakte wurden von der Bürgermeisterin dem Anne-Frank-Projekt des Oberstufenzentrums Werder bereitgestellt.
Schüler der Projektgruppe berichteten bei dem Termin von einer Exkursion mit dem Aktionsbündnis für ein Weltoffenes Werder an frühere Lebensorte jüdischer Mitbürger in Werder, die von den Nazis vertrieben und ermordet worden waren.
Bürgermeisterin Saß begrüßt, dass sich junge Menschen in der Stadt mit diesem Kapitel der Geschichte auseinandersetzen: „Das Erinnern an die deutsche Nazi-Vergangenheit darf ebenso wenig aufhören wie das Engagement gegen Verfolgung, Krieg und Gewalt in der Gegenwart.“
https://werder-havel.de/politik-rathaus/aktuelles/neuigkeiten/politik-rathaus/3705-gedenken-an-resi-salomon.html